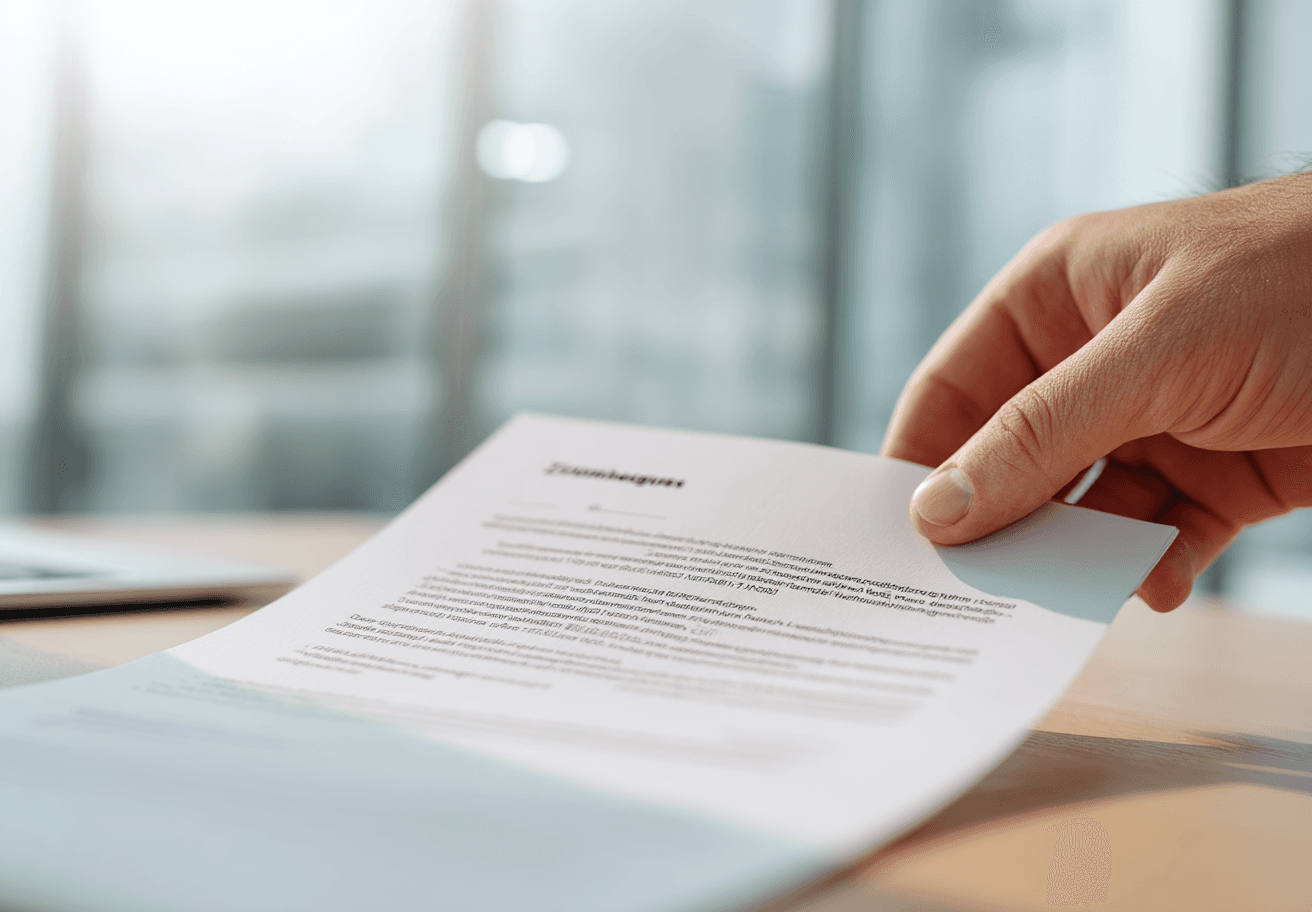Ein Zwischenzeugnis ist ein Arbeitszeugnis, das während eines laufenden Arbeitsverhältnisses ausgestellt wird. Es dokumentiert die bisherigen Leistungen, das Verhalten sowie die Tätigkeiten von Mitarbeiter*innen bis zu einem bestimmten Zeitpunkt, ohne dass ein Austritt aus dem Unternehmen bevorsteht. Anders als das Abschlusszeugnis, das am Ende eines Arbeitsverhältnisses ausgestellt wird, dient das Zwischenzeugnis einer Standortbestimmung und ist ein wertvolles Führungs- und Personalinstrument. Unternehmen nutzen es, um Leistungen transparent zu machen, Vertrauen zu schaffen und die Motivation zu fördern. Zu den Gründen für ein Zwischenzeugnis zählen insbesondere triftige Gründe wie Veränderungen in der Organisationsstruktur, ein Wechsel der Abteilung, ein Vorgesetztenwechsel, neue Stellenangebote innerhalb des Unternehmens, Veränderungen im Aufgabenbereich oder ein geplanter Vorgesetztenwechsel. Auch arbeitsvertragliche Regelungen, eine bevorstehende Kündigung oder andere betriebliche Gründe können einen Anspruch auf ein Zwischenzeugnis begründen.
Rechtliche Grundlagen und Anspruch
In Deutschland besteht kein gesetzlich geregelter Anspruch auf ein Zwischenzeugnis, wie es bei Endzeugnissen der Fall ist. Das Gesetz, insbesondere § 109 Gewerbeordnung, regelt den Anspruch auf ein Arbeitszeugnis bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses, sieht aber keinen ausdrücklichen Anspruch auf ein Zwischenzeugnis vor. Dennoch hat sich in der arbeitsgerichtlichen Praxis etabliert, dass Arbeitnehmer*innen ein Zwischenzeugnis verlangen können, sofern ein berechtigtes Interesse besteht. Die Voraussetzungen und Ansprüche für die Beantragung eines Zwischenzeugnisses ergeben sich aus dem Arbeitsvertrag, tariflichen Regelungen oder aus dem Recht auf Nebenpflichten des Arbeitgebers*der Arbeitgeberin. Ein solches Interesse liegt etwa bei organisatorischen Veränderungen, einer bevorstehenden Elternzeit, einer internen Bewerbung oder einem Vorgesetztenwechsel vor.
Die Beantragung eines Zwischenzeugnisses kann formlos per E-Mail an den Chef oder die Personalabteilung erfolgen. Bei der Beantragung sollte auf die Angabe des Grundes für das gewünschte Zeugnis geachtet werden, um Missverständnisse zu vermeiden. In manchen Fällen kann eine unerwartete oder häufige Beantragung den Verdacht auf einen geplanten Jobwechsel wecken und als Signal für eine bevorstehende Kündigung interpretiert werden.
Für Unternehmen ist es sinnvoll, den Umgang mit Zwischenzeugnissen in einer internen Policy zu regeln. So lassen sich Standards für Inhalte, Form und Anlässe definieren, was sowohl Transparenz als auch Gleichbehandlung fördert. Zwar besteht keine direkte gesetzliche Pflicht zur Ausstellung, doch ergibt sich aus der arbeitsvertraglichen Fürsorgepflicht auf Seiten der Arbeitgeber*innen eine indirekte Verantwortung, berechtigte Anliegen ernst zu nehmen und fair zu behandeln. Wird ein berechtigter Wunsch auf ein Zwischenzeugnis abgelehnt, kann dies zu Misstrauen, Demotivation oder sogar rechtlichen Auseinandersetzungen führen.
Seit 01.01.2025 kann ein Arbeits-/Zwischenzeugnis mit Einwilligung des*der Beschäftigten elektronisch mit qualifizierter elektronischer Signatur erteilt werden (§ 109 Abs. 3 GewO n. F.).
Arten von Zwischenzeugnissen
Zwischenzeugnisse lassen sich grundsätzlich in zwei Hauptarten unterteilen: das einfache Zwischenzeugnis und das qualifizierte Zwischenzeugnis. Das einfache Zwischenzeugnis beschränkt sich auf die sachliche Auflistung der bisherigen Tätigkeiten und Aufgabenbereiche des Arbeitnehmers*der Arbeitnehmerin, ohne eine Bewertung der Arbeitsleistung oder des Sozialverhaltens vorzunehmen. Es eignet sich vor allem dann, wenn lediglich ein Nachweis über die bisherige Beschäftigung und die übernommenen Aufgaben benötigt wird.
Das qualifizierte Zwischenzeugnis hingegen geht deutlich weiter: Hier werden nicht nur die Tätigkeiten detailliert beschrieben, sondern auch eine umfassende Beurteilung der Leistungen und des Verhaltens vorgenommen. Die Bewertung der Arbeitsleistung, des Engagements und der Zusammenarbeit mit Kolleg*innen, Vorgesetzten und Kund*innen macht das qualifizierte Zwischenzeugnis zu einem wichtigen Dokument für Bewerbungen und die berufliche Weiterentwicklung. Gerade bei internen oder externen Bewerbungen ist ein qualifiziertes Zwischenzeugnis oft ein entscheidender Vorteil, da es die Kompetenzen und Erfolge des Arbeitnehmers*der Arbeitnehmerin transparent darstellt. Unternehmen sollten daher sorgfältig abwägen, welche Art von Zwischenzeugnis im jeweiligen Fall angemessen ist, um den Ansprüchen des Mitarbeiters*der Mitarbeiterin und den Anforderungen des Arbeitsrechts gerecht zu werden.
Form und Inhalt: Qualitätskriterien für Unternehmen
Ein professionelles Zwischenzeugnis sollte nach festen Qualitätsstandards erstellt werden. Es beginnt mit der korrekten Bezeichnung “Zwischenzeugnis” in der Überschrift, um eine klare Abgrenzung zum Endzeugnis zu schaffen. Im Fließtext werden Personalien wie Name, Position und Eintrittsdatum genannt. Zudem kann der Anlass für das Zeugnis, beispielsweise ein bevorstehender Abteilungswechsel, genannt werden.
Die Beschreibung der Tätigkeiten erfolgt detailliert und sachlich, idealerweise chronologisch oder nach Verantwortungsbereichen gegliedert. Ein wichtiger Teil des Zwischenzeugnisses ist die präzise Angabe des Aufgabenbereichs und der Tätigkeitsbereiche, da diese die Art und Dauer der ausgeübten Tätigkeiten umfassend darstellen und für die Bewertung der Kompetenzen sowie die rechtliche Einordnung des Arbeitszeugnisses von Bedeutung sind. Hier zeigt sich, wie umfassend der*die Mitarbeitende in Projekte eingebunden war, welche Aufgabenbereiche betreut wurden und mit welchen Ergebnissen. Im Anschluss folgt die Leistungsbeurteilung, die Aussagen zu Fachkenntnissen, Arbeitsweise, Belastbarkeit, Zielorientierung und unternehmerischem Denken enthalten sollte. Die Formulierungen sollten wohlwollend, aber auch differenziert sein, um ein realistisches Bild zu vermitteln.
Auch das Sozialverhalten gegenüber Vorgesetzten, Kolleg*innen, Kund*innen oder Geschäftspartner*innen wird beurteilt. Hier zeigt sich, ob jemand teamfähig, kommunikativ und konfliktfähig agiert. Den Abschluss bildet ein wertschätzender Dank für die bisherige Zusammenarbeit, verbunden mit guten Wünschen für die weitere Zusammenarbeit, sofern das Arbeitsverhältnis fortgeführt wird. Besonders bei Zwischenzeugnissen ist auf die Gegenwartsform zu achten, da die Leistungen weiterhin erbracht werden.
Inhaltliche Bausteine eines qualifizierten Zwischenzeugnisses:
Einleitung mit Personalien: Name, Geburtsdatum, Eintrittsdatum, aktuelle Position, ggf. Anlass für das Zeugnis.
Tätigkeitsbeschreibung: Detaillierte Darstellung der bisherigen Aufgaben, Verantwortungsbereiche und Projekte.
Leistungsbeurteilung: Bewertung von Fachwissen, Arbeitsqualität, Engagement, Zuverlässigkeit, Belastbarkeit und Zielorientierung.
Verhaltensbeurteilung: Einschätzung des Sozialverhaltens gegenüber Vorgesetzten, Kolleg*innen, Kund*innen oder Geschäftspartner*innen.
Schlusssatz: Ausdruck von Wertschätzung und ggf. Ausblick auf die weitere Zusammenarbeit.
Unterschied zwischen Zwischenzeugnis und Arbeitszeugnis
Der wesentliche Unterschied zwischen einem Zwischenzeugnis und einem Arbeitszeugnis liegt im Zeitpunkt der Ausstellung und im jeweiligen Zweck. Während das Arbeitszeugnis in der Regel nach der Beendigung des Arbeitsverhältnisses ausgestellt wird und die gesamte Dauer der Beschäftigung sowie die abschließende Beurteilung der Arbeitsleistung und des Verhaltens des Arbeitnehmers*der Arbeitnehmerin umfasst, wird das Zwischenzeugnis während eines bestehenden Arbeitsverhältnisses erstellt.
Das Zwischenzeugnis spiegelt den aktuellen Stand der Leistungen und das Verhalten des Arbeitnehmers*der Arbeitnehmerin wider und wird häufig bei Veränderungen im Arbeitsverhältnis, wie einem Wechsel der Position, einer Versetzung oder vor einer längeren Abwesenheit, angefordert. Es dient dazu, die bisherige Entwicklung und die momentane Bewertung festzuhalten, ohne dass das Ende des Arbeitsverhältnisses bereits absehbar ist. Im Gegensatz dazu dokumentiert das Arbeitszeugnis die Leistungen und das Verhalten abschließend und ist ein wichtiger Bestandteil bei der Beendigung des Arbeitsverhältnisses. Für Unternehmen ist es daher wichtig, beide Zeugnisarten klar voneinander zu unterscheiden und die jeweiligen Anforderungen an Inhalt und Form zu beachten, um den arbeitsrechtlichen Vorgaben und den berechtigten Interessen des Arbeitnehmers*der Arbeitnehmerin gerecht zu werden.
Chancen und Risiken aus Unternehmenssicht
Ein Zwischenzeugnis bietet Unternehmen zahlreiche Vorteile. Es schafft Transparenz über die bisherige Entwicklung und fördert eine wertschätzende Feedbackkultur. Insbesondere in wachstumsstarken Organisationen mit häufigen Rollenwechseln kann es ein wichtiges Instrument der Personalsteuerung sein. Mitarbeitende fühlen sich gesehen und anerkannt, wenn ihre Leistungen dokumentiert werden. Dies stärkt nicht nur die Bindung, sondern erleichtert auch interne Wechsel oder Nachfolgeplanungen.
Gleichzeitig birgt das Zwischenzeugnis auch Risiken. Überzogene Bewertungen können später zu rechtlichen Problemen führen, insbesondere wenn das Endzeugnis deutlich abweicht. In diesem Zusammenhang kann ein Zwischenzeugnis für Arbeitgeber*innen eine rechtliche Falle darstellen, wenn spätere Bewertungen von der ursprünglichen Einschätzung abweichen. Ebenso können unklare oder doppeldeutige Formulierungen zu Missverständnissen führen. Ein weiterer kritischer Punkt ist die uneinheitliche Praxis: Werden Zeugnisse willkürlich oder nur selektiv ausgestellt, kann dies das Betriebsklima belasten. Zudem kann die plötzliche Beantragung eines Zwischenzeugnisses beim Arbeitgeber*bei der Arbeitgeberin den Verdacht auf eine bevorstehende Kündigung oder einen Jobwechsel wecken. Daher empfiehlt es sich, klare Standards zu etablieren und Führungskräfte im Umgang mit Zeugnissprache zu schulen.
Prozessempfehlungen für Unternehmen
Damit Zwischenzeugnisse im Unternehmen konsistent und rechtssicher ausgestellt werden, sollten feste Prozesse etabliert werden. Eine zentrale Empfehlung ist die Einführung einer unternehmensweiten Richtlinie, die Anlässe, Inhalte und Zuständigkeiten definiert. Diese Policy sollte allen Führungskräften und HR-Verantwortlichen bekannt sein und regelmäßig überprüft werden.
Vorlagen helfen, sprachliche Konsistenz und rechtliche Sicherheit zu gewährleisten. Dabei sollten Templates so gestaltet sein, dass sie individuelle Ergänzungen zulassen und nicht zu starren Textbausteinen verkommen. Der Erstellungsprozess sollte außerdem ein Review durch die Personalabteilung oder die Rechtsabteilung vorsehen, insbesondere bei komplexen Fällen.
Eine transparente Kommunikation mit dem*der Mitarbeitenden ist essenziell. Die Beantragung eines Zwischenzeugnisses erfolgt häufig per E-Mail; hierfür können Vorlagen für E-Mails genutzt werden, um die Kommunikation zu erleichtern und eine professionelle Anfrage sicherzustellen. Wer ein Zwischenzeugnis anfragt, sollte wissen, wann es erstellt wird, wie der Inhalt zustande kommt und welche Bedeutung das Dokument hat. Auch Feedbackgespräche im Anschluss sind hilfreich, um Missverständnisse zu vermeiden und gegenseitige Erwartungen zu klären. Abschließend sollte jedes ausgestellte Zeugnis archiviert und dokumentiert werden, um im Bedarfsfall als Referenz dienen zu können.
Checkliste für Zwischenzeugnisse
Damit ein Zwischenzeugnis den arbeitsrechtlichen Anforderungen entspricht und sowohl für Arbeitnehmer*innen als auch für Arbeitgeber*innen eine verlässliche Grundlage bietet, empfiehlt sich die Nutzung einer Checkliste. Folgende Punkte sollten bei der Erstellung oder Anforderung eines Zwischenzeugnisses unbedingt beachtet werden:
Überschrift und Datum: Das Dokument muss eindeutig als „Zwischenzeugnis“ gekennzeichnet sein und das Ausstellungsdatum enthalten, um Verwechslungen mit anderen Zeugnissen zu vermeiden.
Personalien: Vollständige Angaben zu Name, Vorname, Geburtsdatum sowie das Eintrittsdatum in das Arbeitsverhältnis sind unerlässlich (gemäß Grundsatz der Datenminierung (Art. 5 Abs. 1 lit. c DSGVO)).
Stellenbezeichnung und Tätigkeiten: Die genaue Position des*der Mitarbeitenden im Unternehmen sowie eine präzise Beschreibung der Aufgabenbereiche und Verantwortlichkeiten sollten aufgeführt werden.
Beurteilung von Leistung und Sozialverhalten: Eine differenzierte Bewertung der fachlichen Leistung, des Engagements und des Verhaltens gegenüber Vorgesetzten, Kolleg*innen und Kund*innen ist zentraler Bestandteil eines qualifizierten Zwischenzeugnisses.
Begründung: Der Grund für die Ausstellung des Zwischenzeugnisses kann benannt werden, insbesondere wenn ein triftiger Grund wie ein Vorgesetztenwechsel, eine Versetzung oder eine längere Abwesenheit vorliegt, bietet sich dies an, da sich so Diskriminierungs- und Datenschutzrisiken reduzieren.
Schlussformel: Ein wertschätzender Abschlusssatz, der den Dank für die bisherige Zusammenarbeit ausdrückt und den Wunsch nach einer weiterhin erfolgreichen Zusammenarbeit betont, rundet das Zeugnis ab.
Unterschrift und Datum: Das Zwischenzeugnis muss von der zuständigen Führungskraft oder dem direkten Vorgesetzten handschriftlich unterschrieben und datiert werden, wobei der Name in Maschinenschrift sowie die Funktion der unterzeichneten Person unter der Unterschirft zu stehen hat. Unterzeichnen sollte der*die Weisungsbefugte.
Formale Anforderungen: Das Zeugnis sollte auf offiziellem Briefpapier des Unternehmens erstellt werden und alle erforderlichen formalen Angaben enthalten, um die Seriosität und Rechtsgültigkeit zu gewährleisten.
10 häufig gestellte Fragen (FAQs)
Hat jede*r Mitarbeitende Anspruch auf ein Zwischenzeugnis?
Ein gesetzlicher Anspruch besteht nicht, wohl aber ein Anspruch bei berechtigtem Interesse.Wann liegt ein berechtigtes Interesse vor?
Bei Vorgesetztenwechsel, Abteilungswechsel, Fortbildung, Elternzeit, Sabbatical oder interner Bewerbung.Wie unterscheidet sich das Zwischenzeugnis vom Endzeugnis?
Es wird in der Gegenwartsform geschrieben und beschreibt den aktuellen Stand, ohne dass ein Austritt bevorsteht.Muss der*die Arbeitgeber*in dem Wunsch auf ein Zwischenzeugnis nachkommen?
Wenn ein berechtigtes Interesse vorliegt, sollte dem Wunsch stattgegeben werden.Was passiert, wenn der*die Arbeitgeber*in kein Zwischenzeugnis ausstellt?
Wird bei berechtigtem Interesse abgelehnt, kann der Anspruch arbeitsgerichtlich durchgesetzt werden.Wie detailliert muss ein Zwischenzeugnis sein?
Es sollte Tätigkeiten, Leistungen und Sozialverhalten differenziert und nachvollziehbar darstellen.Darf der*die Mitarbeitende den Inhalt beeinflussen?
Ein Mitspracherecht besteht nicht, aber es kann um bestimmte Formulierungen gebeten werden.Wie oft kann ein Zwischenzeugnis angefragt werden?
Es sollte nicht inflationär genutzt werden, sondern bei triftigen Anlässen.Wie wird das Zwischenzeugnis rechtlich eingeordnet?
Es gilt als offizielles Dokument und kann später als Beweismittel dienen.Was ist bei der Sprache im Zwischenzeugnis zu beachten?
Wohlwollende, aber wahrheitsgemäße und eindeutige Formulierungen sind entscheidend.Gibt es Vorlagen oder Muster für die Beantragung eines Zwischenzeugnisses?
Ja, es stehen zahlreiche Vorlagen und Muster zur Verfügung, die als Orientierung für die Beantragung per E-Mail oder Brief genutzt werden können. Solche Vorlagen helfen, die korrekten Angaben und die passende Kürze zu wahren und erleichtern die Erstellung eines professionellen Anforderungsschreibens.
Fazit
Das Zwischenzeugnis ist ein vielseitiges und strategisches Werkzeug im Personalmanagement. Es bietet Orientierung, fördert eine transparente Unternehmenskultur und stärkt die Bindung zwischen Unternehmen und Mitarbeitenden. Um seine Wirkung voll zu entfalten, braucht es klare Standards, sorgfältige Formulierungen und eine transparente Kommunikation. Richtig eingesetzt, wird das Zwischenzeugnis zu einem Ausdruck von Wertschätzung und Professionalität.
Rechtsstand des Beitrags: November 2025